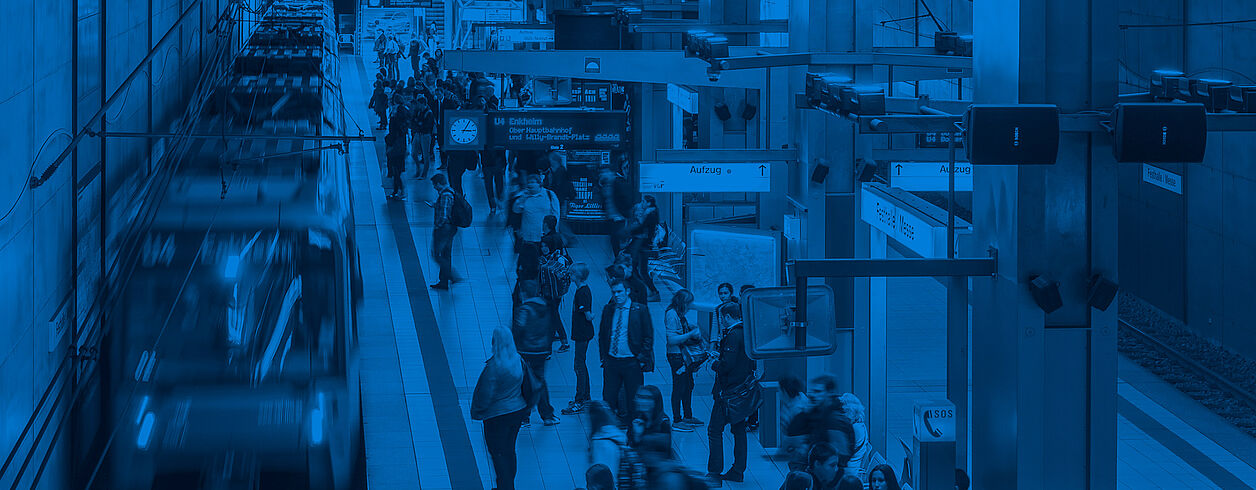KNUT - On-Demand-Verkehr im Frankfurter Norden
Es muss nicht immer Linienbus, U- oder Straßenbahn sein: Mit dem On-Demand-Angebot Knut profitieren Fahrgästen im Frankfurter Norden von einem ganz flexiblen Nahverkehr. Drei elektrische Kleinbusse sind täglich von 18.00 bis 06.00 Uhr im Einsatz – ohne feste Abfahrtszeiten und ohne feste Strecken. Zwischen 0 und 5 Uhr ersetzt KNUT dabei die Nachtverkehre der Linien 28 und 29. Die Linien 39 und 63 werden zwischen 1 und 4 Uhr durch KNUT ersetzt. Für den Ein- und Ausstieg stehen den Fahrgästen rund 1.600 "virtuelle", aber auch schon bestehende Haltestellen zur Verfügung. Fahrten zwischen den Stadtteilen sind ebenso möglich wie Fahrten zu Umsteigepunkten wie den U-Bahnstationen Nieder-Eschbach, Bonames Mitte, Uni-Campus Riedberg, Preungesheim, Weißer Stein, Heddernheim, Gravensteiner Platz, Nordwestzentrum und Kalbach sowie den S-Bahnstationen Berkersheim, Eschersheim, Frankfurter Berg und Bad Vilbel Bahnhof. Ab dem 14. Dezember 2025 wird das Bediengebiet auf die gesamte Stadt Bad Vilbel erweitert.